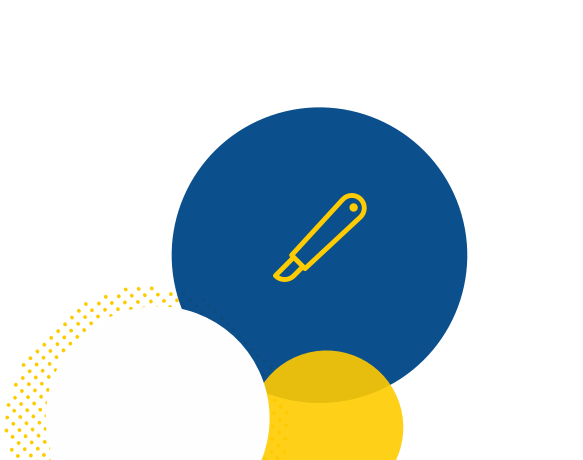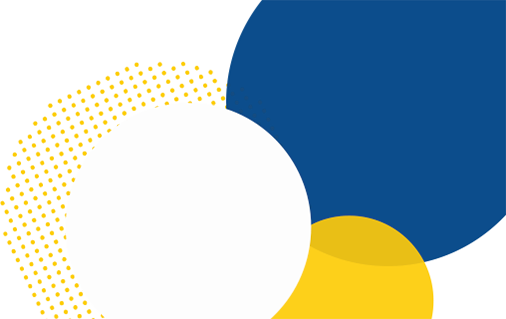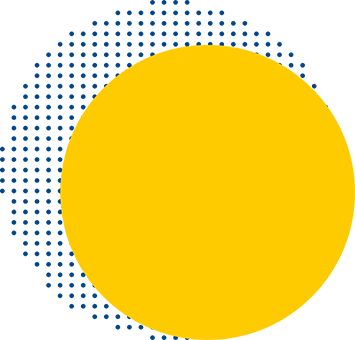Urologie
Die Fachabteilung für Urologie unter Leitung von Dr. med Gautier Müllhaupt heisst sie herzlichst am Spital Thun willkommen.
Als regionales Versorgungszentrum bieten wir ihnen modernste diagnostische und therapeutische Verfahren auf höchstem Niveau regional vor Ort an.
Unser professionelles dynamisches Team nimmt in den Sprechstunden im urologischen Ambulatorium am Spital Thun Zeit für ihre Anliegen und wird ihnen eine persönliche Beratung in vertrauensvollem Rahmen bieten.
Ebenso bieten der Bevölkerung im Simmental und Saanenland eine Sprechstunde vor Ort in Zweisimmen an.
Die Behandlung erfolgt gemäss aktueller internationaler Leilinien auf hohem fachlichem und technischem Niveau. Hierbei decken wir nahezu das gesamte Spektrum der Urologie mit Behandlung von Erkrankungen der harnableitenden Organe wie auch des männlichen Genitales ab.
Für operative Behandlungen können wir ihnen vor Ort nebst Standardverfahren moderne minimal-invasive, endourologische, konventionell und roboterassistiert laparoskopische sowie offenen Operationstechniken anbieten.
Unsere Ärzte verfügen über operative Exzellenz und können sich in unserem neuen OP Zentrum auf neuste Gerätschaften wie den Intuitive DaVinci XI und moderne Holmium high power Laser mit bis zu 150W verlassen und ihnen somit funktionell beste Ergebnisse bieten.
Als anerkannte/zertifizierte Weiterbildungsstätte durch das Schweizer Institut für Weiterbildung und Fortbildung (SIWF) bilden wir Assistenzärzte zur Erlangung ihrer Facharztreife aus und offerieren die Durchführung der Facharztprüfung bei uns. Zudem sind wir seit Januar 2020 als Weiterbildungsstätte in der Erlangung des Schwerpunkt-Titels operative Urologie gelistet.
Die häufigste Krebserkrankung des Harntrakts stellt das Urothelkarzinom der Harnblase dar und macht somit 2 Prozent aller bösartigen Erkrankungen aus. Beim Mann ist es die viert häufigste, bei der Frau die sechst häufige Krebserkrankung. Allerdings verursacht der Blasenkrebs nur rund 3,5% aller Todesfälle durch Krebserkrankungen.
Das chronische Beckenschmerzsyndrom (ChronicPelvic Pain Syndrome, CPPS) beschreibt anhaltende oder wiederkehrende Schmerzen im Beckenbereich, ohne dass eine klare Ursache identifiziert werden kann. Es ist von Schmerzen, die auf eine andere Grunderkrankung (z.B. eine Entzündung) zurückgeführt werden können, zu unterscheiden.
Erektile Dysfunktion (häufig auch «Impotenz» genannt) beschreibt anhaltende Schwierigkeiten beim erreichen oder erhalten einer für einen Geschlechtsakt ausreichenden Erektion. Die Entstehung einer erektilen Dysfunktion ist häufig multifaktoriell bedingt und kann sowohl psychologische als auch organische Ursachen haben.
Die gutartige Prostatavergrösserung betrifft mit zunehmendem Alter fast alle Männer. Symptome und Verlauf der Erkrankung sind dabei sehr verschieden. Die Therapie reicht vom Beobachten über Medikamente bis hin zur Operation. Das Ziel unseres Zentrums in Thun zur Therapie der gutartigen Prostatavergrösserung ist es, für jeden Patienten die ideale Therapie zu finden.
Eine einwandfreie Blasenfunktion setzt eine adäquate Speicherung und eine effiziente Entleerung des Urins voraus. Damit diese Funktion gewährleistet werden kann ist ein komplexes Zusammenspiel von Nerven und Muskeln nötig sowie ein intakter Beckenboden.
Die Harnröhrenenge des Mannes ist ein komplexes Krankheitsbild. Es betrifft ca. 1% der Männer, das Auftreten nimmt mit zunehmendem Alter zu. Ursächlich sind ärztliche Interventionen wie Katheterisierungen oder Operationen am Harntrakt sowie Traumata, wiederkehrende Infekte und selten auch Tumorerkrankungen.
Harnsteine, auch als Nierensteine bezeichnet, sind feste Kristalle, die sich aus Ablagerungen von Salzen und Mineralien im Urin bilden. Sie können in den Nieren, Harnleitern, Blase oder Harnröhre auftreten und können Schmerzen, Blut im Urin oder Probleme beim Wasserlassen verursachen. Die Größe der Steine kann von sehr klein bis zu einer beachtlichen Größe reichen. Die Behandlung von Harnsteinen hängt von ihrer Größe und Lage ab und kann medikamentöse Therapie, Schockwellentherapie oder chirurgische Eingriffe umfassen.
Hodenkrebs ist eine seltene Tumorerkrankung des Mannes. Die meisten Fälle von Hodenkrebs treten bei Männern im Alter von 15 bis 45 Jahren auf, es ist jedoch die häufigste Tumorentität bei jungen Männern. Seltener tritt der Hodenkrebs auch bei älteren Männern auf. Die Heilungsrate ist exzellent und liegt je nach Ausbreitung bei über 99%.
Bösartige Tumoren der Niere (Nierenzellkarzinom) stellen mit 2-3% aller Tumorentitäten den dritthäufigsten urologischen Krebs dar. Häufig wird der Tumor schon in frühem Stadium vom Hausarzt in der Routine Kontrolle im Ultraschall oder im Rahmen von Bildgebungen als Zufallsbefund erkannt bevor es zu Beschwerden kommt.
Ein Peniskarzinom ist ein Krebs, der auf der Haut oder im Gewebe des Penis auftritt. Er ist selten und äussert sich initial als Auswuchs, nicht heilende Wunde oder Ausschlag am Penis. Auch Schmerzen oder Blutungen können auftreten.
Die bösartige Prostataerkrankung (Prostatakarzinom) ist die häufigste Krebsart des Mannes. Das Vorkommen steigt mit dem Alter kontinuierlich an und ist erhöht, wenn Familienangehörige bereits am Prostatakrebs erkrankt sind. Es gibt unterschiedliche Aggressionsstufen und nicht jede bedarf einer unmittelbaren Therapie.
Infektionen im urologischen Fachgebiet betreffen zumeist den Harntrakt. Die Behandlung urologischer Infektionen kann je nach Art und Schweregrad der Infektion variieren, umfasst jedoch häufig die Verwendung von Antibiotika, um die zugrunde liegende Infektion zu bekämpfen.
Die Männermedizin befasst sich mit der Diagnostik und Behandlung von gesundheitlichen Problemen, die spezifisch für Männer sind. Dazu gehören u.a. Prostata- und Hodenerkrankungen, erektile Dysfunktion, Testosteronmangel und männliche Infertilität.
Schon im Kindesalter gibt es eine Reihe an Gründen, warum ein Urologe konsultiert werden sollte. Hierzu zählen vor allem Fehlbildungen, Infektionen des Harntrakts sowie Probleme mit dem trocken werden.