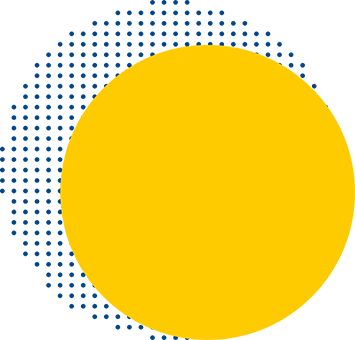Brustkrebszentrum
Im Brustkrebszentrum Thun-Berner Oberland werden Frauen mit Brusterkrankungen umfassend und kompetent beraten und behandelt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Abklärung und Behandlung von Brustkrebs. Unser interdisziplinäres Team gewährleistet hohe Sicherheit bei gleichzeitig individueller und kontinuierlicher menschlicher Betreuung. Unsere Patientinnen werden einfühlsam auf ihrem Weg von der Diagnose bis zur Therapie betreut. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Seite und in unserer Broschüre.
Die Deutsche Krebsgesellschaft e.V. (DKG) hat dem Brustkrebszentrum der Spital STS AG am Spitalstandort Thun rückwirkend per Ende August 2019 die Zertifizierung als Organkrebszentrum verliehen. Das Brustkrebszentrum Thun-Berner Oberland ist damit das erste regionale Spitalzentrum im Kanton Bern und neben Universitäts- und grossen Kantonsspitälern das zwölfte Kompetenzzentrum in der Schweiz überhaupt, welches diese Zertifizierung erlangt. Seither wird das Zentrum jedes Jahr auditiert und erhielt im Jahr 2022 die Rezertifizierung.
Brust-Magnetresonanzbildgebung (MRI)
Das MRI ist ein bildgebendes Verfahren, das ohne Röntgenstrahlen auskommt. Durch Spritzen eines Kontrastmittels können Areale mit vermehrter Durchblutung (Entzündung, Krebs) sichtbar gemacht werden.
Brust-Screening Kanton Bern
Das offizielle Brustscreening-Programm im Kanton Bern wird von der Organisation «Donna» durchgeführt.
Anhand dieses Programms erhalten sämtliche Frauen ab dem 50. Lebensjahr alle zwei Jahre schriftlich eine Einladung zu einer Mammografie. Die Teilnahme an diesem Programm ist freiwillig. Das Spital Thun ist Leistungserbringungsstandort für das Mammographie-Screening-Programm.
Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link.
Qualitätssystem
Im Brustkrebszentrum orientieren wir uns am Qualitätssystem der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) und sind seit 2019 nach diesem Label zertifiziert. So ermöglichen wir Krebskranken in jeder Phase ihrer Erkrankung eine Behandlung, die sich an hohen Qualitätsmassstäben orientiert.
Wir verstehen uns als Netzwerk aus stationären und ambulanten Einrichtungen, in denen alle an der Behandlung eines Krebspatienten beteiligten Fachrichtungen eng zusammenarbeiten. Wir unterziehen uns jährlich einer strengen Qualitätskontrolle nach einheitlichen Massstäben. Die Qualitätsindikatoren werden in interdisziplinären Kommissionen erarbeitet und regelmässig aktualisiert. Leitlinien sind die Grundlage für die Festlegung der Qualitätsindikatoren. So soll sichergestellt werden, dass sich die Behandlung an den besten zur Verfügung stehenden medizinischen Evidenzen orientiert.
Brustultraschall (Mammosonografie)
Unter Mammosonografie versteht man die Ultraschalluntersuchung der Brust. Sie ist eine ergänzende Untersuchung nach der Mammografie. Gerade bei jüngeren Frauen kommt sie jedoch auch als erstes bildgebendes Verfahren zum Einsatz. Sie erlaubt die Durchführung einer eventuellen Punktion unter Sichtkontrolle. Bei unklaren oder verdächtigen Befunden erfolgt in einem nächsten Schritt eine derartige Punktion zur Entnahme einer Zell- oder Gewebeprobe.
Digitale Mammografie
Die Mammografie ist die Röntgenuntersuchung der Brust. Sie ist nach wie vor der Goldstandard in der Bildgebung und eignet sich auch für Screening-Untersuchungen (in regelmässigen Abständen erfolgende Untersuchungen zur Früherkennung von Brustkrebs). Die Strahlenbelastung ist dabei minimal und kann vernachlässigt werden. Die Untersuchung erfolgt durch die Radiologie des Spitals. Eventuelle weitergehende Abklärungen finden in der Brustsprechstunde statt.
Klinische Untersuchung
Die Inspektion und das Abtasten der Brust sind die Basis einer jeden Abklärung bei Beschwerden oder Befunden der Brust. In einem nächsten Schritt kommen bildgebende Verfahren zum Einsatz.
Punktionen
- Feinnadelpunktion (FNP)
- Stanzbiopsie (StB)
Punktionen, die im Falle der FNP und StB unter US-Kontrolle durchgeführt werden, dienen der Gewinnung von Zellen oder Gewebezylindern zur Diagnosestellung oder -sicherung. Nur selten ist bei einem unklaren Resultat der Punktion für die Diagnosestellung eine offene Gewebeentnahme (Biopsie) im Operationssaal in Narkose notwendig.
Minimalinvasive Tumorentfernung (Mammotome)
Gutartige Knoten (z. B. Fibroadenome) können heutzutage bis zu einer Grösse von 2.5 bis 3cm mittels einer Vakuumbiopsie (Mammotome) in Lokalanästhesie in unserer Brustsprechstunde entfernt werden. Es handelt sich dabei um einen risikofreien ambulanten Eingriff.
Operationen bei Mammakarzinom (Brustkrebs)
Die Eingriffe werden in Zusammenarbeit mit dem Onkologiezentrum Thun-Berner Oberland geplant durchgeführt.
Beratung von Risikopatientinnen (Genetische Beratung)
Ausgehend von ihrer persönlichen Kranken- und Familiengeschichte beraten wir Frauen auf Wunsch in einem ausführlichen Gespräch über ihr persönliches Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Wir geben Ihnen Tipps zur Verminderung des Brustkrebsrisikos und Empfehlungen über Art und Intervall von sinnvollen Kontrollen. Die Beratung erfolgt in Zusammenarbeit mit Kolleginnen der Humangenetik der Universität Bern in einer Sprechstunde bei uns am Spital Thun.
Breast Care Nurse (BCN)
Die Breast Care Nurse I (BCN) ist eine spezialisierte Pflegefachfrau, welche Brustkrebspatientinnen und ihre Angehörigen betreut und berät. Sie arbeitet eng mit dem Fachpersonal der Frauenklinik zusammen. Die Breast Care Nurse begleitet die Patientinnen ab Diagnosestellung bis zur Nachsorge, bietet geeignete Interventionen an und/oder weist die Betroffenen an die richtige interdisziplinäre Stelle weiter. Sie geben den von Brustkrebs betroffenen Frauen und deren Familien pflegespezifische Informationen, Schulungen und Beratungen.
Als fester Bestandteil des multidisziplinären Teams übernimmt die BCN I eine zentrale Rolle in der Sicherstellung und Koordination der Behandlung und Pflege.
Weitere Angaben finden Sie in unserem Flyer.
Die Studienkoordination der Spital STS AG
Das Brustkrebszentrum am Spital Thun beteiligt sich aktiv an klinischen Studien sowie der Entwicklung von innovativen Medikamenten und neuen Technologien, um Krebs zu heilen.
Die Ärztinnen und Ärzte können ihrer Patientin vorschlagen, im Rahmen der Forschung an einer nationalen oder internationalen klinischen Studie teilzunehmen.
AXSANA Studie (Beobachtungsstudie)
Eine Studie mit dem Ziel verschiedene axilläre operative Techniken weltweit zu vergleichen, bei Patienten mit Brustkrebs und Lymphknotenbefall nach neoadjuvanter Chemotherapie vor primärer systematischer Therapie. Die Studie ist eine sogenannte nicht-interventionelle Studie, dabei werden die Teilnehmenden nur beobachtet. Die Daten dienen dazu, durch den Vergleich der Techniken unter ähnlichen klinischen Bedingungen das Ausmass der Krankheit zu bestimmen. Durchgeführt wird die Studie von EUBREAST (European Breast Cancer Research Associaton of Surgical Trialist) und in verschiedenen Zentren weltweit durchgeführt. Das Brustkrebszentrum Thun – Berner Oberland ist eines der Zentren, welches sich an dieser Studie beteiligt.
Unterstützungsangebote
Selbsthilfegruppen bieten ein wertvolles Netz zwischenmenschlicher Hilfe
In einer Selbsthilfegruppe treffen sich Menschen in ähnlichen Lebenssituationen und mit denselben Anliegen zum Erfahrungsaustausch. Dieser eröffnet ihnen neue Bewältigungsmöglichkeiten, zum Beispiel im Umgang mit einer Krankheit. Die Teilnehmenden finden soziale Kontakte mit Gleichbetroffenen, Verständnis, Unterstützung, Ermutigung und Entlastung. Die Selbsthilfegruppen sind selbstorganisierte Zusammenschlüsse und werden nicht von Fachleuten geleitet.
Selbsthilfe BE informiert und berät Sie über bestehende Selbsthilfegruppen, vermittelt den Kontakt zu den Gruppen oder unterstützt und begleitet den Aufbau einer neuen Selbsthilfegruppe. Das Angebot richtet sich an Betroffene wie auch an interessierte Angehörige. Hier finden Sie den dazugehörigen Flyer.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen.
Unsere Beratungen sind kostenlos. Wir behandeln alle Anfragen vertraulich.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Selbsthilfe BE.
Flyer:
KREBS FORDERT HERAUS – WIR SIND FÜR SIE DA
Die Krebsliga Bern (KLB) ist Ihre erste Anlaufstelle für Fragen rund um Krebs. Wir beraten Sie in allen Phasen der Krebserkrankung und unterstützen Sie bei der Organisation von Entlastung, beim Kontakt mit den Sozialversicherungen und bei Bedarf auch finanziell. Wir veranstalten Workshops, Kurse, Seminare und Vorträge. Unser Angebot ist kostenlos und richtet sich an Krebsbetroffene, Nahestehende und alle Interessierten.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Krebsliga Bern.
Aktuelles aus dem Spital